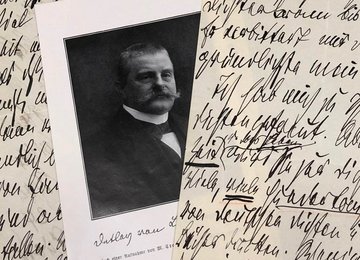Doris Runge

Runge, Doris; geboren als Doris Beckmann.
Doris Runge: Gedichte auf Flügeln
Geboren in Carlow am 15. Juli 1943
Lebt in Cismar.
In ihren Gedichten versammeln sich Undinen, Mönche und das „Tödlein auf der Gartenbank“. Wildnis und Winter treffen auf „schwarze Wörter“ oder auf „blattgrüne Himmel“, Und selbst der Sonntagmorgentreff in der Bäckerei kippt bei Doris Runge vom handfesten Sein ins Entrückte. So in einem der Gedichte in der Sammlung Man könnte sich ins Blau verlieben. Ihrer Lieblingsfarbe hat die Dichterin 2014 damit einen ganzen Gedichtband gewidmet. „Das Blau wohnt in meinen Gedichten“, sagt sie dazu. Dazu muss das Wort selbst übrigens keineswegs im Gedicht vorkommen. Aber wer sich in ihr Werk vertieft, der spürt, wie sehr das stimmt.
Kein Wunder, die Dichterin ist ein Kind des Nordens, 1943 geboren in Carlow in Mecklenburg – einer Landschaft, die sie mit ihrer Weite und den endlosen Himmeln bis heute prägt und beschäftigt. 1953 zog Doris Runge mit den Eltern und der Schwester aus der DDR nach Neukirchen, Schleswig-Holstein. Und fand hier manches von der alten Heimat wieder. „Wenn ich mir ein Sehnsuchtsland vorstelle“, erzählt sie in einem Gespräche, „dann ist das Mecklenburg und Steckrüben.“
Aufgewachsen auf dem Dorf, Lehramtsstudium in Kiel, Wanderjahre in Spanien, mit ihrem ersten Ehemann, dem Maler Jürgen Runge, während derer sich das Schreiben zusehends zum Lebenszweck entwickelte. 1976 dann Cismar, der Einzug ins Pförtnerhaus des ehemaligen Klosters, wo sie mit ihrem Mann Reiner Binkowski bis heute lebt. Dem Land zwischen Acker und Küste ist sie treu geblieben. Wenn sie ein Stadtmensch wäre, sagt sie, „dann würde ich andere Gedichte schreiben“.
Liebe, Träume und Tod sind ihre großen Themen. Immer schon, nur mit den Jahren haben sich die Schwerpunkte verschoben. Der erste Gedichtband Jagdlied erschien 1985, erhielt für die sinnlich farbigen Stillleben, die aufs äußerste verknappten Bilder den Friedrich-Hebbel-Preis. Von da an kamen die Bücher ungefähr im Dreijahrestakt. Gedichte, in denen der Moment einfriert verdichtet und verknappt wie in Ikarus: „Das herz randvoll / mit himmel / als die Erde / mein raubvogel / immer größer / und dunkler werdend / mich mitten / im flüchtigen traum / schlug“ Jedes Wort trägt Bedeutung in Runges Gedichten, die Begriffe gehen unverhoffte Wahlverwandtschaften ein – und im Rhythmus kabbelnder Ostseewellen schlagen die Zeilen voran. Im 2013 zu ihrem 70. Geburtstag von Heinrich Detering herausgegebenen Sammelband Zwischen Tür und Engel lässt sich das schwebend Doppelsinnige dieser Lyrik erkunden.
Doris Runge betreibt Präzisionsarbeit, geht mit dem Seziermesser an die Sprache, verknappt, entschlackt – und das Eigentliche passiert zwischen den Zeilen. Die Bilder schöpft die Dichterin aus ihrem Innern, aber auch aus der Märchen- und Sagenwelt mit ihren Meerfrauen und Vampiren, aus der Natur, die ihr Haus umgibt und die in ihrer Erinnerung wohnt. „Meine Gedichte sind immer nächtliche Gespräche mit meinem lyrischen Ich“, beschreibt sie den Vorgang des Dichtens. Mit den Mönchen, die einmal in Cismar gelebt haben. Mit den Märchenfiguren aus ihrer Kindheit. Oder mit den Kollegen von Rainer Maria Rilke bis Thomas Mann.
Das literarische Erbe spiegelt sich in ihren Gedichten, mit den Verweisen, den Anklängen und Echos. Die Dichterin ist sich dabei treu geblieben über die Jahrzehnte, auch wenn einige der jüngeren Gedichte auf den ersten Blick handfester, welthaltiger erscheinen. Da führt ein Fahrstuhl in Rapunzels Zimmer, trifft Geistergesang auf Plastikflasche, steht man beim Bäcker „mit alf und peter und co / und coffee to go …“ – bevor die Glocken läuten, „wenn einer dann doch / gegangen ist“. Das zu schreiben habe ihr Spaß gemacht, hat die Lyrikerin erzählt. Die Gedichte aus den letzten Jahren sind stärker im Alltäglichen verwurzelt, heiterer im Ton. Die Gegenwart ist die Grundierung, auf der sie ihre luftig strenge Lyrik ausbreitet: „Das ist auch eine Form von Gesellschaftskritik.“.
Gleichzeitig ist der Ton immer fragiler geworden. Wie in Blind Date (2010), diesem abgesagten Rendezvous mit dem Tod: „Es muss ja nicht / gleich sein / nicht hier sein / zwischen tür und / engel abflug / und ankunft / in zugigen höfen / es könnte Z im sommer sein / wenn man / den schatten liebt / es wird keine / liebe sein / jedenfalls keine / fürs leben“.
Dass sie in Cismar wohnt, in dieser bewussten Isolation und fast ein bisschen am Rand der Welt, hat auch mit Abgrenzung zu tun. Gegen zu viel Welt, zuviel Ablenkung vom eigenen Innenleben. Was nicht heißt, dass Doris Runge nicht auch gesellig wäre. Im Gegenteil: Das Weiße Haus in Cismar ist über die Jahre nicht nur ihr Schreibort, sondern auch literarischer Treffpunkt geworden; mit der Lyrikerin als Gastgeberin und Literaturvermittlerin. Die, unterstützt vom Literaturverein im Weißen Haus, regelmäßig Leser und Literaten versammelt, präsentiert – und bekocht. Marcel Reich-Ranicki und Ehefrau Teofila hat sie ebenso bewirtet wie Georg Klein, Sigrid Damm, Jochen Missfeldt, Friedrich Christian Delius, Silke Scheuermann, Feridun Zaimoglu, Jan Wagner. Ein Who is Who der deutschsprachigen Literaturszene, unter die sich zuweilen auch noch internationale Gäste wie Lars Gustafson mischten.
Leserin ist Doris Runge übrigens nach eigenem Bekunden noch vor der Dichterin. Und wenn sie sich etwas wünschen dürfte, dann wäre es ein zweites Leben: „Damit ich die Bücher lesen kann, die ich bisher nicht geschafft habe – und die anderen noch einmal, die ich vor langer Zeit gelesen habe.“ Das spiegelt sich in den literarischen Verweisen, den Wiedergängern und Echos.
Sie hat sich früh in der Literatur ihre Gefährten gesucht. Schon im Kinderzimmer im Mecklenburgischen hat sie mit ihrer Schwester die Geschichten aus den Kinderbüchern zum Einschlafen weitergesponnen. Sie mag es, dem Bekannten ins Ungewisse zu folgen, ihm eine neue Wendung zu geben. Und auch die eigenen Gedichte enden selten da, wo sie begonnen haben.
Immer steckt in ihren flüchtigen Zeilen auch etwas sehr Erd-, dem Leben Verbundenes. Und jene feine Ironie, die der Unausweichlichkeit des Lebens ein Schnippchen schlägt – und sie aushält. „Elstern folgen / füchse nehmen / witterung / du aber fürchtest dich // vor dem schnee / vor der stille / vor dem gläsernen / gesicht“, so klingt es im Gedicht „Antwort“ (1995). Eine Reflexion über die Angst, die uns im Nacken steckt und den Schritt lähmt. Doris Runge traut sich den Blick auf die dunklen Seiten; das Unheimliche hat sie immer schon angezogen.
Zurück zu Man könnte sich ins blau verlieben, Doris Runges vorläufig jüngste Lyriksammlung. Ein schmales Bändchen, das leicht in der Hand wiegt, aber Zeit braucht, den Inhalt der aufs Äußerste verknappten Zeilen zu entfalten. Flüchtig und durchscheinend die „Wolkentiere“, „die weißen / die lämmerwölkchen …“. Zum ironisch melancholischen Standbild verknappt die Karlsbader Elegie, in der späte Liebe auf träumende Olgas trifft und die Liebe an Geld und Wunschtraum zerschellt. Verschmitzt die Kapitel „Hier war doch Licht“ oder „Sonntags morgens“. Und dann sind da noch die farbstarken, von Ernst-Ludwig Kirchners und Emil Noldes Malerei inspirierten Gedichte und die mecklenburgischen Impressionen, in denen Doris Runge der verstorbenen und schmerzlich vermissten Schwester nachsinnt.
Außerdem ist Blau die Farbe der Poesie seit Novalis, und die einzige, die der große Gottfried Benn darin gelten ließ. Dass der Dichter sie außerdem als „das Südwort schlechthin“ charakterisiert hat, weckte allerdings den Widerspruch in Doris Runge: „Nein, sage ich: Blau ist ein Nordwort! Ich mag auch diese blassen Blautöne, die rasant wechselnden Himmel.“ Und für Goethe war Blau sowieso die „Grenzfarbe zur Dunkelheit“.
„Ruhe und Abgeschiedenheit“, sagt Doris Runge „die haben wir hier nur im Winter.“ Wenn die Tage kurz sind und der Himmel über dem Kloster Cismar tief, dann ist für die Lyrikerin die Zeit zum Schreiben, oben in dem kleinen Zimmer im Weißen Haus, das einst der Amtsschreiber bewohnte, mit Blick auf den Klostergraben und über die Straße ins Vogelschutzgebiet. „Zum Schreiben muss ich den Alltag abwerfen“, sagt sie, „erst dann kann ich auch darüber schreiben.“ In den sonnenverwöhnten Tagen des Sommers hat sie in ihrer Küche, in der man am langen Tisch so gut reden kann, oft schon eine kleine Sehnsucht nach Winter.
Vom oberen Stockwerk geht der Blick nochmal nach draußen, auf einen kleinen Teich. Auf dem sind gerade mal keine Enten unterwegs, aber für Doris Runge ist er „der Landeplatz für Musen“ vor ihrer Haustür. Ihnen erzählt sie im ersten Gedicht des Buches: „für engel / langhälsige / entenfüßige / heimwehkranke // für musen / auf der suche / nach geöffneten / fenstern.“
Irgendwann ist das Knappe, Reduzierte ihre Form geworden. „Ich male gern Bilder mit meinen Gedichten“, sagt sie, „die Zeilen finden mich.“ Nachts notiert sie, was ihr einfällt. Das Ausarbeiten kommt später, aber das Dichten hört ja nicht auf, bloß weil Sommer ist: „Das ist eine Freude, Worte zu finden, ihnen Wahlverwandtschaften zu geben.“ Und „Wortfalltüren“ einzubauen, an denen der Leser im Sein den unsicheren Boden spürt. So entfalten sich hinter der Verknappung die Geschichten. Doris Runge liebt es, den Gedanken zu entblättern, das Bild soweit zu klären, bis der Kern sichtbar wird: „Ich muss jedes Wort darauf prüfen, ob es stimmt.“
Doris Runge hat den Kunstpreis Schleswig-Holstein (1998) und den Hölderlin-Preis erhalten (1997). Sie ist Ehrenprofessorin des Landes und seit 2011 in der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Und der kleine Hörsaal im Audimax reichte nicht aus, als sie am 10. April 1997 in der Kieler Uni antrat, über ihr Schreiben zu erzählen. Die Dichterin aus Cismar war die erste Liliencron-Dozentin der damals von Heinrich Detering neu geschaffenen Poetikdozentur in Kiel. Und der Andrang war damals so groß, dass man schließlich in den großen Saal umzog.
„Die Welt von Doris Runges Gedichten ist immer auf der Kippe“, beschreibt Heinrich Detering im Nachwort zu Zwischen Tür und Engel das Bezwingende ihrer Lyrik. „Immer ungewiss und geheimnisvoll. Aber sie enthält auch das Versprechen eines geheimen Zusammenhangs, für den „Liebe“ kein unpassendes Wort ist.“
Dabei wirken ihre Gedichte so fein gesponnen und luftig, als wollten sie gleich abheben. Natürlich beschäftigt sie das Alter, dass die Strecke, die vor ihr liegt, kürzer ist als die, die sie bereits zurück gelegt hat. Diejenigen, die zu Lesungen im Weißen Haus waren und nicht mehr da sind wie Hans Wollschläger oder Peter Rühmkorf. Aber der Tod schreckt sie nicht: „Ich bin noch da“, sagt sie und wischt energisch eine Haarsträhne aus dem Gesicht, „und ich bin noch neugierig auf die Welt.“ Auch wenn die gerade mal wieder ihre Abgründe offenbart. „Mein Leben lang hat mich meine Herkunft beschäftigt“, sagt sie. „Vertreibung, Flucht, DDR. Und heute stellen sich dieselben Fragen neu.“
Die Lyrik scheint dagegen manchmal ein Mittel: „Die Poesie ist so etwas wie das andere Gedächtnis. Das Dichten hat ja mal mit allerlei Bannsprüchen begonnen.“ Gegen Angst, Krieg, Naturkatastrophen. „Wörter“, sagt Doris Runge, „sind zwar flüchtig, aber auch das einzige, womit ich mir eine Welt baue.“ „Übrigens“, schreibt sie mit einem Augenzwinkern am Ende ihres Vorworts zu der Chronik, die Reiner Binkowski zum Jubiläum mit Texten von Birgit Vanderbeke bis Jan Wagner herausgebracht hat, „Hofmannsthal ließ sich in / einer Franziskanerkutte beerdigen. / Wie ich das machen werde, darüber denke ich nach.“
05.07.2021 Ruth Bender
Video
Audio
Doris Runge liest für das Literaturtelefon Kiel aus ihrem 2017 im Wallstein Verlag erschienenen Lyrikband man könnte sich ins blau verlieben. Die Aufnahme entstand am 12.12.2018 im Literaturhaus SH. Link: http://www.literaturtelefon-online.de/?page_id=3155
Veranstaltungen
Keine Veranstaltungen vorhanden
INSTITUTIONEN
WERKE
• Kunst-Märchen Berlin: Kunst-Edition Fannei 1977.
• Liedschatten. Cismar: o.V. 1981.
• Jagdlied. Gedichte. Stuttgart: DVA 1985.
• Doris Runge und Wolfgang Fratzscher. Der Vogel, der morgens singt. eine lyrische Reise. Hrsg. von S. Marien. Cork-Irland: Verlag Buddy - Preinersdorf-Chiemsee 1985.
• kommt zeit. Gedichte. Stuttgart: DVA 1988.
• wintergrün. Gedichte. Stuttgart: DVA 1991.
• grund genug. Gedichte. Stuttgart: DVA 1995.
• trittfeste schatten. Gedichte. Stuttgart, München: DVA 2000.
• Du also. Gedichte. München: DVA 2003.
• Die Dreizehnte. Gedichte. München: DVA 2007.
• Literaturhaus Schleswig-Holstein, Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein: Littera Borealis 7: Doris Runge Kiel: Sparkassenstiftung 2008.
• Was da auftaucht. Gedichte. München: DVA 2010.
• Zwischen Tür und Engel: Gesammelte Gedichte. Ausgewählt und mit einem Nachwort von Heinrich Detering. München: DVA 2013.
• man könnte sich ins blau verlieben. Gedichte. Göttingen: Wallstein 2017.
• die schönsten versprechen. Gedichte. Göttingen: Wallstein 2022.
• von liebe viel. Gedichte. Göttingen: Wallstein 2023.